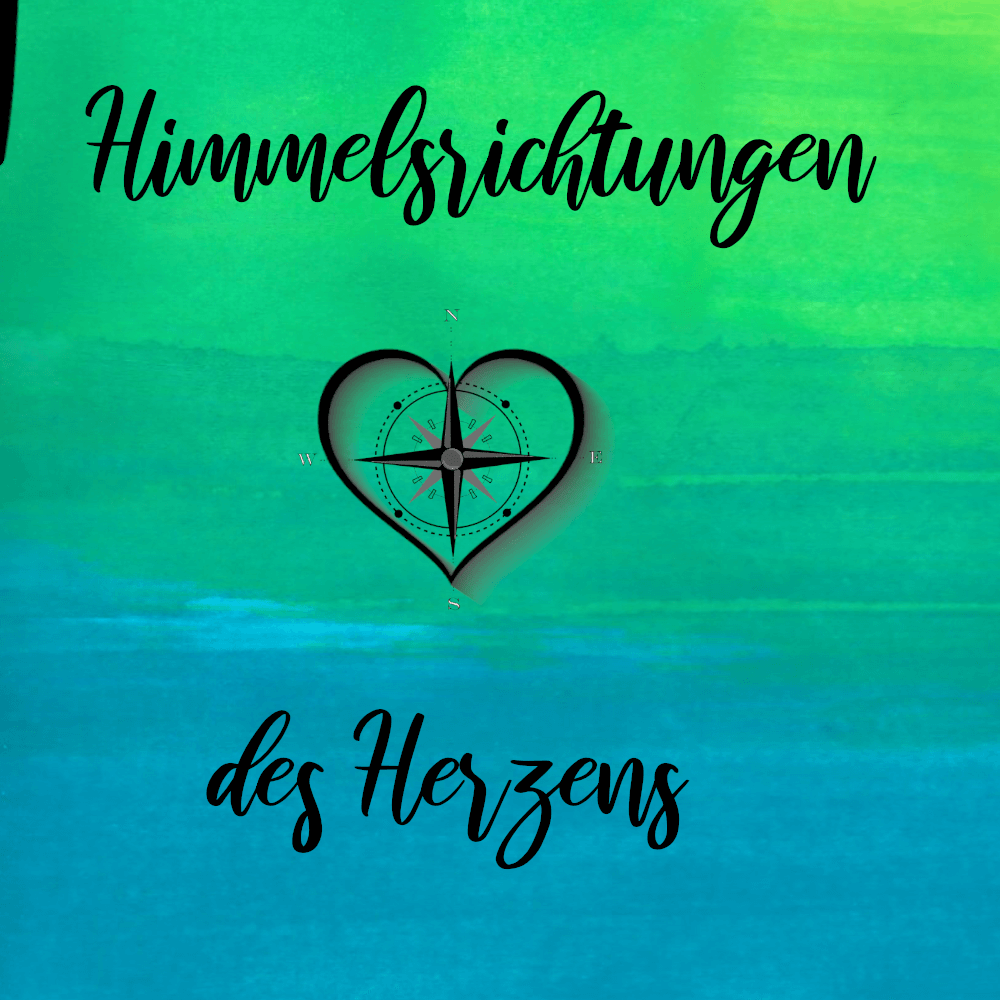
Wie kommt man dazu, im ersten Pärchenurlaub jemand anderen zu küssen?
Tja. Wir schaffens zwar bis zum Mond, aber scheitern hinreißend an dem Menschen, der nachts neben uns liegt. Fegen manchmal übereinander hinweg wie Sommergewitter in den Bergen. Finden uns im Gleichklang des Atems wieder, sprechen wahr und verletzlich. Machen uns nackt und breiten die Arme zu Schmetterlingsflügeln aus.
… Der Titel dieser Kurzgeschichte ist kitschig und der Rest wird nicht besser! Ich mag sie trotzdem. Oder gerade deswegen.
Himmelsrichtungen des Herzens
Violette Schlieren am Himmel hieven ein Goldstück den Horizont hinauf. Makellose Lichtausläufer werfen Schattenspiele auf geschlossene Lider, Unschuld und Tau bedecken noch die Wiesen. Bis sich die Sonnenwärme unter Zeltwänden staut und beides sich auflöst. In der beginnenden Hitze lässt zweifach erwachendes Bewusstsein verworrene Bilder aufsteigen, nennt sie den gestrigen Tag. Die alte Identität formt sich, und mir wird schlecht.
»Guten Morgen«, hauche ich, heimlich hoffnungsvoll.
Das Gestern besteht zwar aus nichts als Gedanken, die aber in der Gegenwart weiterschwingen. Deine eben noch schlafentspannte Augenpartie verhärtet sich. Den Reichtum deines Blickes enthältst du mir vor und deine Lippen sind schmal verkniffen, als du hervorpresst: »Du hast alles kaputt gemacht.«
Du ziehst den Satz wie ein Schwert. Es saust scharf zwischen uns herab, zerschlägt alle zartgeknüpften Bande. Da flüchte ich Hals über Kopf vor deiner kalten Schulter, die du mir jetzt zuwendest, nackt und trotzig. Arme und Beine winden sich aus dem Schlafsackgefängnis.
Vor dem Zelt im schieren Gegensatz dazu: blanke Morgenschönheit. Glitzerwunder perlen auf entspannter Wasseroberfläche, und der See, umthront von majestätischen Berggipfeln, döst in all seiner Vollkommenheit vor sich hin.
Es ist unser erster gemeinsamer Urlaub. Eine Prüfung, die es nach neun Monaten unruhiger Zweisamkeit zu bestehen gilt, und von der ich bete, noch nicht daran gescheitert zu sein. Denn eigentlich bin ich doch fürchterlich verliebt in dich. Würde nur nicht fortwährend die Gegensätzlichkeit zwischen uns schwelen. Wäre nur gestern unser wackeliges Harmoniegebäude nicht eingestürzt.

Als ich vom Schwimmen zurückkomme, sitzt du vor dem Zelt. Wir brühen schwarzbitteren Genuss mit dem Campingkocher auf, ohne ihn genießen zu können. Beide halb erschlagen von der kurzen Nacht, beide zwischen ratlos und rastlos beginnen wir ein Schachspiel, da sind immerhin die Regeln eindeutig. In vierundzwanzig Stunden ist Abreise, uns bleibt nicht viel Zeit, um zu retten, wenn es etwas zu retten gibt.
Vorsichtiges Herantasten: »Wollen wir darüber reden?«
Dein prompter Konter: »Gibt es denn etwas zu reden?«
»Hendrik …«
Aber du hast keine weiteren Worte für mich übrig. Du bleibst mir heute das fremde, kalte Rätsel, an dem ich im Alltag so oft verzweifle. Doch weil sich auch jedes Wunder über seine Unerklärlichkeit definiert, macht mir das nur zeitweilig etwas aus. Die restliche Weile bestaune ich es.

Schwüle senkt sich zum Mittag hin über das Tal, macht Glieder und Kopf schwer, wir spielen drei Stunden am Stück, am Ende verliere ich – ein Gefühl, das ich oft mit dir habe.
»Bitte rede mit mir.«
Ich, vehementer.
Aber jede Wiederholung der immergleichen Bitte macht mich auch wütender auf dich und die Stimmung schlägt zum Nachmittag hin um. Am klarblauen Himmel beginnen sich von Süden her die Wolken zu türmen. Baumwipfel in der Ferne neigen sich im Takt plötzlich aufbegehrender Windmusik, ein Donner rollt über den See und warnt vor dem herannahenden Unwetter.
Gemeinsam gehen wir stillschweigend Geschirr waschen, obwohl kaum ein Bissen angerührt wurde. Auf dem Weg zurück, du auf einmal: »Wuäh, wo hastʼn du Spülen gelernt? Der Teller ist ja noch fettig wie Sau.«
Ein Blitz durchschneidet hysterisch die romantische Bergseekulisse, ich fahre herum. »Den ganzen Tag redest du einen Scheiß mit mir, aber um dich zu beschweren gehtʼs dann wieder oder was?!« Und da platzt mit einem Schlag auch aller Regen auf einmal aus dem dicken Wolkenwanst am Himmel hervor. Das Vordach des Waschhäuschens hält unsere hitzigen Köpfe trocken, eventuell ein Fehler. Der nächste Blitz zuckt auf, es knallt ohrenbetäubend.
»Du bist diejenige, die sich mal entschuldigen könnte!«
»Du bist derjenige, der mich ignoriert! Der nicht spricht, der mich nicht an sich ranlässt!«
»Kein Wunder bei deiner Art, Liebe zu zeigen, oder?«
»Meiner Art – meiner? Dein Herz kennt nur tiefsten Nordwinter! Es ist immer verschneit und klirrend kalt und menschenleer!«
»Ach so, und du bist dann wohl was … immer Südsommer?«
»Immer sonnig und offenherzig.«
»Du meinst wohl offen für jedermanns Zunge, na herzlichen Glückwunsch! Oberflächlich und bindungsunfähig!«
Das sitzt. Aber jedes schmerzende Saatkorn der Wahrheit wird in heftigem Gestikulieren davongefegt, noch bevor es keimen kann. »Nur, weil ich nicht so ein stumm verstockter Fisch bin wie du, heißt das noch lange nicht, dass ich … dass …«
Doch ein Keim. Gestern Abend, die Feierlust hängt in den Straßen des nahen Städtchens. Fußpaare springen ausgelassen auf der Kiesmatratze am Ufer, begleitet von einer Gitarre, einem Sänger, einem Kachon. Du foppst mich, machst dich über meinen Tanzstil lustig, steckst mir Kieselsteine in das Dekollété, so wie es immer mit uns ist, du meinst das ja nicht so.
»Warum zur Hölle hast du ihn geküsst?!«
Deine goldenen Katzenaugen funkeln angriffslustig.
Du bist dir ein Eis holen gegangen, mir wolltest du keines mitbringen, »geh selbst, du bequemes Mädchen!«, hast dann aber später doch eines für mich dabei, ich sehe es im Augenwinkel, während der andere mich im Arm hält. Der ist zuvor aus einer wildfreien Menge an zappelnden Gliedmaßen aufgetaucht, und du kamst und kamst nicht zurück. Dafür der andere, freizügig Komplimente verschenkend und … »Warum denn nicht? Es ist Sommer, er tanzte schön, wo ist eigentlich dein fucking Problem? Du warst ewig verschwunden, ich dachte, du bist einfach wieder mal abgehauen!«
»Quatsch, ich bin doch nur kurz ein Stück am See entlang gelaufen – da war so viel Trubel, ich … Ich verstehe dich einfach nicht! Es war so ein schöner Abend, das war so überflüssig, du bist so egoistisch!«
Es klirrt.
»Das war meine Lieblingstasse, du Arschloch!«
»So fühlt sich das an, wenn etwas kaputt geht, was einem wichtig ist!«
Gleißende Blitze tanzen über den verdüsterten Nachmittagshimmel und der Donner bemüht sich, die Felswände ringsrum zum Einstürzen zu bringen. Und wir beide mittendrin, zerstören uns im Gewitter unseres Unverständnisses füreinander, während die Regenschleier peitschend unter das Vordach wehen. Der Sommersturm tost, ringt mit der Welt um ihren Untergang.

Als am frühen Abend Wind und Regen allmählich verstummen, ist die Seeoberfläche noch aufgewühlt. Sie ist in der Ferne mit dem Himmel zu einer einzigen grauen Front verwaschen, ein in sich verschlungenes Knäuel aus Wetter und Wasser. Nach dem Sturm ist nichts mehr da draußen oder da drinnen noch voneinander zu trennen.
»Du lässt dich nicht ein«, »du zerrst an mir«, »du bist unnahbar«, »du bist flatterhaft«, ein unzuordbarer Haufen an Worten. Und all das jähzornig Vorgeworfene liegt nun ausgebreitet zwischen uns und betrifft in Wahrheit immer uns beide und niemals nur einen. Unsere Beziehung ist ein Spiegelkabinett. Ergibt es Sinn, seinen Spiegel zu zerschlagen?
Was vom Geschirr noch heil ist, tragen wir ermattet zum Zelt zurück.

Von der Eiche zum Auto haben wir unsere Wäscheleine gespannt. Dort hängen nun die Regentropfen fein aufgereiht zum Trocknen. Auch die Wolkenfelder lösen sich voneinander, über uns entsteht eine neue Ordnung, die wir nicht begreifen. Abgerissene Fetzen werden von Westen her angestrahlt, beleuchten die abendliche Himmelskathedrale in warmen, schillernden Farben. Als hätten die letzten zwei Stunden gar nicht existiert. Als wäre das mit dem Weltuntergang nur ein albernes, dummes Missverständnis gewesen.

Bald ist vom Tag nicht viel mehr als ein tiefroter Lichtstreifen am Horizont übrig. Sich von hinten anschleichende Finsternis frisst unbemerkt die spärlichen Überbleibsel vollends auf.
»Wir sind einfach zu unterschiedlich.« Du, deprimiert. »Gegensätze ziehen sich vielleicht an, aber sie passen nicht zusammen.«

Nachts wälzen wir uns angespannt über die Isomatten, erst gehst du noch mal spazieren, dann ich, dann liegen wir wieder halb im Dämmerschlaf, entkräftet von der kurzen Nacht zuvor, vom sengend heißen Tag und fragen uns beide, ob es nun vorbei ist mit uns.
Wir sprechen nicht, nur unsere Rücken schauen sich gegenseitig an. Und die Rücken rutschen sich irgendwann näher, berühren sich wie ausversehen, verharren beieinander.
Vielleicht brauche ich jemanden, der an mir zweifelt, denke ich, weil ich selbst die ganze Zeit an mir zweifle. Du bist mein externalisierter Zweifel, den ich dann selbst in mir nicht mehr spüren muss. Kämpfen wir miteinander, aber gegen uns selbst?
»Ich bin müde«, flüstere ich.
»Dann schlaf doch«, kommt patzig zur Antwort.
»Anders müde. Des Kämpfens müde.«
Erst brütende Stille.
Eine Weile darauf dann ein ergebenes Seufzen aus den tiefsten Winkeln deines Brustkorbes.
»Ich … auch.«
Unsere Fingerspitzen finden einander auf deiner Hüfte, dem höchsten Punkt zwischen uns, begegnen sich zaghaft ersehnend. Beim Luftholen berühren sich die Rücken noch stärker. Wir, die unüberbrückbar Unterschiedlichen, atmen im Gleichklang.
»Ich verstehe dich nicht«, du sagst es wieder, aber diesmal knallst du mir den Satz nicht gewaltsam im Gegenangriff vor die Brust, sondern offenbarst ihn mir in barer Verzweiflung, auf der Zunge liegt dein Herz und spricht diesmal. Da kann ich endlich ehrlich hinlauschen, da vertraue ich deinem haltgebenden Rücken und meine Worte fließen aus dem Innersten, zeigen sich genauso schutzlos und verletzlich wie deine.
»Ich habe mich vielleicht von dem gestern küssen lassen, weil … ich Angst vor dir habe. Vor deiner Art. Weil ich mich dir unterlegen fühle, wenn du mich ständig kritisierst. Weil ich das Gefühl habe, du hältst mich so auf Abstand.«
Kurzes Schweigen. Ein zögerlicher Antwortversuch: »Vielleicht … halte ich dich auf Abstand, weil ich auch Angst habe. Mich ganz einzulassen und von dir verletzt zu werden, wenn du mich eines Tages verlässt, weil ich … nicht genug Süden in mir trage.«
Erneutes Schweigen. Eine Schicht mehr bricht auf. »Vielleicht … habe ich auch Angst, dass wenn wir uns voll aufeinander einlassen, merken, dass wir tatsächlich nicht gut zusammenpassen. Oder noch schlimmer: Uns miteinander langweilen.«
»Vielleicht habe ich Angst, dass es anstrengend wird. Dass sich mein Leben verändert, wenn ich dich ganz reinlasse.«
»Vielleicht habe ich Angst, mich selbst zu enttäuschen, wenn du mich ganz reinlässt und ich merke, du bist ganz anders als meine verliebte Illusion von dir.«
»Vielleicht habe ich Angst vor der Schönheit des Menschen, den du in mir siehst, der ich nur in Teilen bin, aber vielleicht zu mehr Teilen sein könnte, weil du ihn siehst. Vielleicht habe ich Angst, uns beide zu enttäuschen.«
Wir drehen uns zueinander um.
Die Verteidigungswälle des anderen haben wir längst eingerissen, aber unsere eigenen, die fallen erst jetzt, die müssen wir selbst niederringen. Und endlich lässt du mich ganz in deinen Herznorden vordringen und da schmilzt auch das Gold in deinen Augen. Flüssige Lichtblicke rinnen die Wangen hinab, klären die Sicht aufeinander.
Ich, unsicher: »Was … wenn wir uns einfach enttäuschen lassen würden und hinter der Täuschung eine viel großartigere Wahrheit auf uns wartet?« Weil Verschiedenheit sich auch ergänzt. Weil zwei entgegengesetzte Himmelsrichtungen gemeinsam mehr Facetten der Wirklichkeit abbilden können als eine alleine.

In der Finsternis kriechen wir aus dem Zeltkokon wie verwandelte Raupen. Und leise flüsterst du deinen Zauberspruch, der trägt uns durch die schwärzeste Beziehungsnacht, der öffnet uns für die Synergie, auch, wenn wir sie jetzt noch nicht sehen können: »Ich verstehe dich nicht, aber: Ich liebe dich.«
Und mehr als das braucht es nicht.
Im Morgengrauen durchkämmt fließender Nebel die Grashalmspitzen, hinterlässt dort Tau und Unschuld. Nackt springen wir in den See, makellos, die Arme zu Schmetterlingsflügeln ausgebreitet.