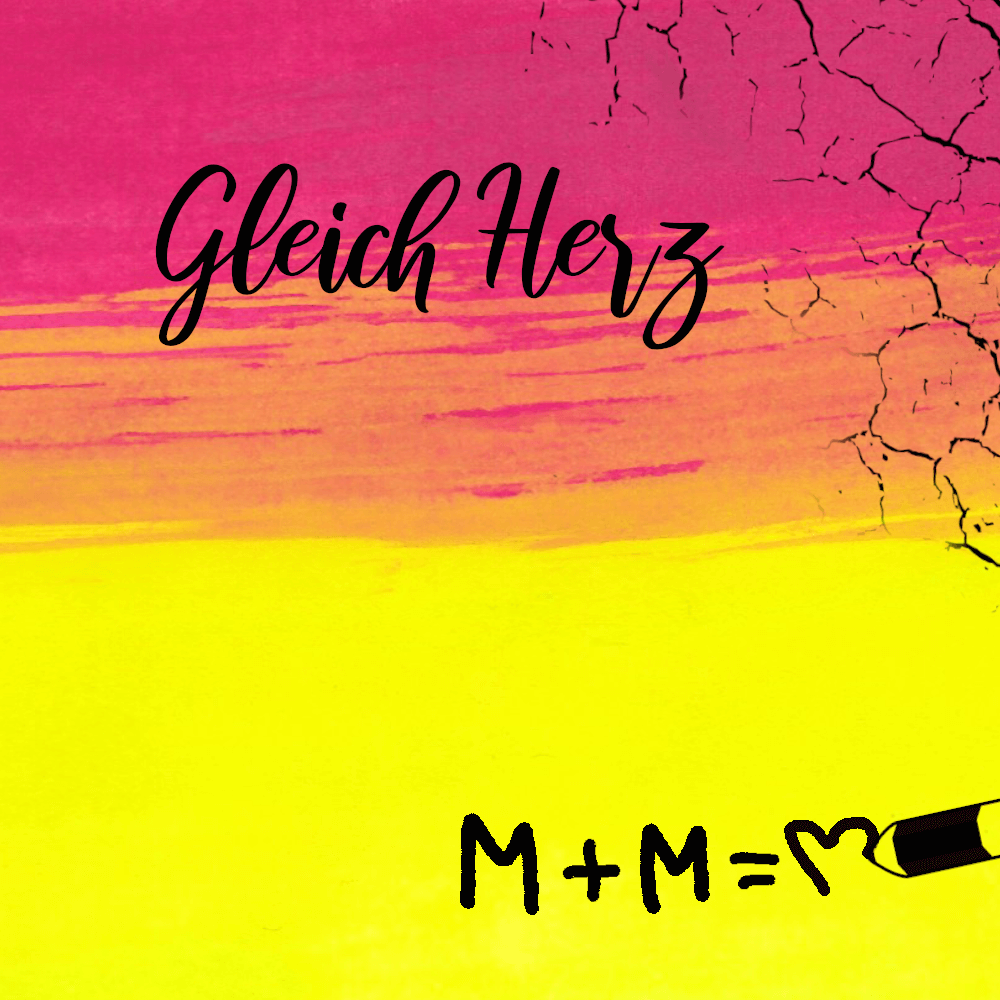
„Warum lässt du mich dann nicht los?“
Das fragt Marie ihren Freund. Halt nein, die beiden befinden sich ja zurzeit in keiner Beziehung … also dann eben ihren Nichtfreund, mit dem sie quasi zusammen ist, aber eben nicht in einer als Paarbeziehung definierten Konstellation. Oder so. Aber genauso entschlossen wie Marie ist, einen neuen Beziehungsversuch im ständigen On-off zu wagen, ist Marian unentschlossen. Aber loslassen will er auch nicht.
Zu einer Beziehung gehören immer zwei. Zu einer Trennung aber auch. Irgendwie. Jedenfalls, bis sich einer wirklich trennt.
Gleich Herz
Das Etikett der Flasche habe ich beinahe abgefriemelt, als das Mädchen ihre Zunge endlich in deinem Hals versenkt. Ihr steht auf der Wiese unter den bunten Lampions, im Hintergrund die Musik, die tanzenden Menschen, und mein Herz zerspringt beim Anblick dieser Romantik, zu pur und zu unschuldig. Ich weiß ja, du musst sie küssen. Du musst es tun, um zu wissen, dass du zu mir gehörst. Der Mensch ist ein Wesen, das nach dem Ausschlussverfahren funktioniert – nichts kann ohne die Erfahrung des Gegenteils existieren, nur wenn du sie küsst, wirst du wissen, wie gut es mit mir ist. Und ich muss es mir ansehen, denn es ist wie ein umgekehrter Unfall, es ist so schön, dass man nicht wegsehen kann, küssende Menschen sind unendlich ästhetisch. Und der wahre Unfall findet hier bei mir statt, weil es mir trotzdem das verdammte Herz zerreißt, euch zuzusehen.
Mehrere Sommerabende zuvor, so viele, dass zwischen ihnen ganze vier Winter lagen, habe ich dich zum ersten Mal so geküsst, nicht auf dieser Party, auf einer anderen, und wir haben uns mit unseren niedlichen zwanzig Jahren in eine Beziehung gestürzt. Es ging nicht lange gut. Wir waren so jung, dass wir alle zwischenmenschlichen Fehler aneinander austesten mussten, leidenschaftlich, schrecklich verliebt und dumm. Dann gingst du ein Semester ins Ausland, Funkstille. Zwischen uns. Und jetzt dieses andere Mädchen.

Vorhin erst balgten wir beide noch gemeinsam in der Sommerschwüle durch die Mohnblumen und die Margeriten, die in der unberührten Lücke zwischen Weizen und Wald wachsen. Mein Gesicht beugte sich über deines, bis nah an deine Augen heran. Und wie ich hineinsah, fand ich die Scherben darin. Sie lagen am Grunde der seichten Pfütze deiner Iris, im gespiegelten Himmelsblau. Bruchstücke, die im Sonnenlicht funkelten.
»Marian«, sagte ich und fiel in deinen Blick, »uns beide trennt nicht mehr als drei Buchstaben, es wäre albern, wenn wir die nicht überwinden könnten.«
Ein Zucken lief durch deinen Blick und weil ich noch in ihm lag, kam es für mich einem Erdbeben gleich, einer Erschütterung allem zwischen uns Bestehenden.
»Du weißt …« Er zögerte. Er wartete, bis ich den Satz selbst beendete. Er wartete solange, bis ich es tatsächlich tat, weil ich das Schweigen zwischen uns noch mehr hasse als die Worte.
»Ich weiß, du weißt nicht, was du willst. Es ist egal.« Und wir wussten beide, dass diese Behauptung purer Unfug ist.
Du dummer Junge, schalt ich dich im Stillen, warum begreifst du auch deine Einfältigkeit nicht? Was suchst du da draußen im Unbekannten, wenn der Schatz, den es bergen könnte, bereits hier vor dir liegt!
Aber du weißt das nicht, denn du hast nie etwas anderes erfahren als mich. Wir trafen uns, als du aus Mexiko zurückkamst, die Glut alter Vertrautheit entzündete sich zu neuem Feuer und du offenbartest mir, dass du keinem einzigen anderen Mädchen nahe warst. Du trautest dich nicht. Und wie einmal, nein, sogar dreimal sich stattdessen ein anderes Mädchen traute, ›fühlte es sich nicht richtig an‹ für dich. Solche lapidaren Worte wirfst du mit Vorliebe in all unsere Zwischenräume. Damals willigtest du noch ein, wieder mit mir zusammen zu sein, aber nach einem Jahr hast du eben jene Worte benutzt – es fühlt sich nicht mehr richtig an –, um auch unsere Verbindung wieder zu lösen. Und meine Welt zerfiel.
Tausendmal musste ich in diesem Winter sterben, um im Frühjahr aus der Asche neu geboren werden zu können. Heute Nachmittag zischte ich dann wütend von all dem Hin und Her: »Du wirst immer wollen, was du nicht hast!«
Du hast drei Worte erwidert, sie waren sehr simpel, und danach haben wir unsere Zwischenräume lieber wieder mit Küssen statt Worten gefüllt, das können wir besser.

Ich kann dich ja verstehen, denke ich jetzt, während ich dich dabei beobachte, wie du dem anderen Mädchen über die Lippen streichst, ihre Hand nimmst und sie viel mutiger davonziehst, als deinem Charakter schicklich ist. Es war nicht einfach mit uns, wir haben uns in zwei Pole verrannt, wir haben einen erbitterten Krieg um Nähe und Distanz ausgefochten, in dem ich zur verschlingenden Furie wurde und du zum Eisklotz. Sich zu trennen stand natürlicherweise deiner Rolle zu, auch wenn ich diesen Bruch gleichermaßen provoziert habe. Acht Monate brauchte es, bis wir einander wieder in den Armen lagen. Genau hier, auf diesem Feldweg, unser Treffpunkt und gleichzeitig die Abkürzung zu deiner Wohnung.
Ich schleiche euch beiden nach, mein Herz klopft verräterisch laut in der heißen Sommernacht, die um halb zwei von dichten Wolken niedergedrückt wird und ihren Zenit an Spannung erreicht.
Nein!, wüte ich im Stillen, das ist nicht dein Ernst, du nimmst sie mit zu dir nach Hause? Ich halte genügend Abstand, um vom Nachtschwarz verschluckt zu sein, und genügend, um euch noch herumalbern hören zu können. Fassungslos bleibe ich stehen, als ihr das Ende des Feldweges erreicht und gemeinsam im ersten Haus verschwindet.
Eine Bierflasche fällt zu Boden, zerspringt klirrend auf Kieselsteinen. Vielleicht fiel sie aber auch nicht, sondern wurde mit aller aufbringbarer Kraft weggeschleudert. Aber was weiß ich schon, ich war mir doch nicht einmal im Klaren darüber, dass ich sie noch in den Händen hielt.
Jetzt lasse ich auch mich auf den Weg fallen, denn dein Zimmer im ersten Stock ist auf einmal erleuchtet. Tränen rinnen mir über das Gesicht, kitschig umrahmt von den ersten, dicken Tropfen, die nun aus der Wolkendecke hervorbrechen und platschend auf den Kieselsteinchen bersten.
Ist doch schön, ich gönne es dir ja, mach du nur deine Erfahrungen, das ist wichtig. Wie willst du mit mir zusammen sein und dich von ganzem Herzen dazu bekennen können, wenn du nie etwas anderes als uns beide erfahren hast? Das verstehe ich schon. Das habe ich zumindest vorhin noch behauptet, eine ganze Weile nachdem du diese drei Worte gesagt hast, und ich wiedermal stur fragte, warum wir unsere Zweisamkeit nicht mehr Beziehung nennen können.
»Weil das nicht funktioniert hat, schon vergessen?«
Aber ist das ein Naturgesetz, dass es niemals funktioniert, nur weil es das ein… na gut, oft nicht funktioniert hat? Mein Blick stürzte ab, fiel zurück in die seichte Pfütze deiner Augen.

›Es funktioniert halt nicht‹, das ist noch so einer dieser Sätze aus dem Kästchen deiner Wortvorlieben. Ich will es anzünden, das verfluchte Kästchen, du sollst nie wieder etwas sagen dürfen, das uns beide voneinander trennt, immerzu bist du derjenige, der solche Keile zwischen uns treibt. Dabei siehst du mich immer ganz mitleidig an, wenn du diese Dinge sagst, und niemand weiß, wem dieses Mitleid wirklich gilt: Mir oder dir selbst.
»Nimm die Scherben aus deinen Augen, sie schneiden mich«, fauchte ich und du weintest wieder, wie so oft in unseren zarten Momenten des Miteinanders. Du weintest und sagtest: »Ich bin halt kaputt, ich bin beziehungsunfähig! Ich krieg das einfach nicht hin, das mit dem Zusammensein!«
»Warum lässt du mich dann nicht los?«, fragte ich, erst nur verzweifelt, dann auch weinend.
»Weil ich es nicht kann, du bist mir doch auch wichtig«, hast du gewinselt, armer, zerbrochener Junge – und ich, ich meinte eben das, wie immer an dem Punkt des Gesprächs: Geh und mach deine Erfahrungen. Ich kann es doch verstehen.
Aber mein Herz kann es nicht. Es zerbricht, weil ich genau weiß, was ihr beide da oben gerade hinter dem erleuchteten Fenster tut. Dabei habe ich es oft getan, denn ich bin nicht wie du, nicht schüchtern. Sondern bin trotzig in die Welt rausgegangen und habe mehr Männer geküsst, als dass ich mich an alle erinnern könnte – aber jeder von ihnen hat mich doch nur ein wenig mehr zurück in deine Arme geschubst. Weil die Magie der Zwischenmenschlichkeit eben doch nicht beliebig reproduzierbar ist.
»Wir gehören zusammen. Und was zusammengehört, das sollte auch zusammen sein und eine Beziehung führen!«, das behaupte ich immer noch mit derselben unerträglichen Vehemenz, in welcher du es dementierst, weil ›Beziehung nur ein Wort ohne Gehalt ist‹.
»Nein, Marie, es ist viel einfacher«, hast du aber diesmal stattdessen gesagt, »eine einfache Gleichung, und mehr als das gibt es nicht über meine Gefühle oder über uns beide zu wissen.«
Ich verstand nicht, natürlich, wie auch, du bist ein Scherbenrätsel. Also maltest du es mir auf, schriebst mir deine Formel mit dem Finger in den Staub des trockenen Feldweges. Erst ein M, dann ein Pluszeichen, ein nächstes M, ein Gleichheitszeichen, dahinter ein Herz.
»Bist du das erste oder das zweite M?«, fragte ich. Aber du meintest, das wäre egal, und ich sagte: »Ich liebe dich.« Das sind meine Kampfworte in unserem Ringen. Wir prügeln uns miteinander, gegeneinander und umeinander.
Und über meinem Kopf grollt der erste Donner, aus den Tropfen wird in Sekundenschnelle ein heftiger Platzregen. Ich sitze am Boden, die Knie angewinkelt und balle die Hände zu Fäusten beim Gedanken an die unfaire Romantik eures geteilten Augenblicks. Wie nah ihr euch wohl nun seid, während draußen der Regen tobt?
Ich aber bleibe regungslos sitzen, die Arme um die Beine geschlungen, zum Unterstellen ist es sowieso zu spät, und mein letzter Funken Würde ist im Regen ertrunken. Es sind schließlich diese Momente jetzt, die alles entscheiden. In denen du rausfindest, ob es wirklich so gut ist, jemand anderem nahe zu sein, oder ob du halt doch zu mir gehörst.
›Ich weiß es nicht‹, echot dein Satz in meinem Kopf. Genau so sehr, wie ich weiß, dass wir zusammen sein sollten, weißt du es nicht.
Über meinem Kopf blitzt und donnert es, doch ich bleibe sitzen, bis das Gewitter längst vergangen ist. Ich bleibe sitzen und warte. Auf dich.

Bis irgendwann der Morgen graut und ich nicht mehr weiß, wann das passiert sein soll. Aber das Mädchen ist nicht herausgekommen. Entweder, ich habe ein Zeitfenster übersprungen und nicht mitbekommen, wie sie gegangen ist … oder sie hat tatsächlich bei dir übernachtet. In deinem Bett. Während ich hier fror und saß, bis alle Glieder taub waren. Längst bin ich wieder trocken, nur noch klamm zumindest, der Sommer ist unerbittlich in diesem Jahr, die ersten Sonnenstunden rücken mit neuer Hitze an.
Meine schwindende Hoffnung schreibt ein M in den Kies und den Staub, und dann noch eines, sie schreibt ein Plus dazwischen und ein Herz hinter das Gleichheitszeichen, an dieselbe Stelle wie du damals. Zwei Jahre ist das schon her, mein Gott. Zwei Jahre, in denen wir uns umeinander im Kreis drehten, nachdem wir ein halbes damit aufgehört haben, bevor wir es vier Monate taten, bevor wir es drei Wochen nicht taten, bevor wir es wieder fünf taten, oder warte, vielleicht … nein, es ist zu verwirrend, ich kann es nicht mal mehr rekonstruieren, es ist pures Chaos.
»Ich liebe dich«, sage ich zu dem M, aber ich weiß nicht zu welchem, weil ich nicht weiß, welches zu dir gehört. Aber vielleicht ist das auch völlig egal, weil die Worte eigentlich sowieso nur bedeuten: Ich liebe mich selbst in deinem Kontext. Und über diesem Gedanken schüttle ich den Kopf und rechne die Formel um.

M gleich Herz minus M. Denn vielleicht komme ich erst heraus, wenn man dich von meiner Liebe abzieht. Oder, rechnet man weiter, ergibt sich sogar Minus M gleich M minus Herz: Zieht man meine Liebe von mir für dich ab, kommst du nur negativ heraus. Was für eine Verschwendung von Liebe!
Der Gedanke hievt meinen Körper hoch. Eingerostet bin ich, und müde, mit Sonnenbrand, und gleichzeitig erfroren von der Nacht. Aber das andere Mädchen ist immer noch nicht herausgekommen, es wird wohl gerade in deinem Arm liegen, und ich frage mich: Was wirst du wohl sehen, wenn du ihr nachher in die Augen blickst?
Ich drehe mich um. Ein Stück entfernt vor mir am Boden ist eine Pfütze, nur noch ein seichtes Überbleibsel des Gewitters der letzten Nacht. Frisches Himmelsblau spiegelt sich darin und auch noch etwas anderes. Scherben. Die Reste meiner Bierflasche.
Ich gehe die paar Schritte hinüber und mein Gesicht beugt sich hinunter, über die Pfütze. Und wie hineinsehe, finde ich mich selbst darin wieder. Mein Spiegelbild zischt in der Erinnerung des letzten Nachmittags noch einmal wütend: »Du wirst immer wollen, was du nicht hast!« Und du sagst in der Erinnerung auch deine drei Worte noch einmal: »Genau wie du.«
Wie man die Formel auch dreht und wendet, kommt letztlich das gleiche Ergebnis heraus. Denn vielleicht sind es gar nicht zwei Buchstaben, sondern nur eine Variable: M plus M.
